
(Am Ende des Textes gibt es eine Audiodatei mit den Sanskritbegriffen)
Mit Beginn des Frühlings erleben wir in vielfältiger Form die „Wiedergeburt“ in der Natur – unmittelbar durch und mit unseren Sinnen. Der Wieder-Geburt muss notwendigerweise ein Tod vorausgegangen sein. Und dem Tod eine Geburt. Geburt und Tod, das Werden und Sterben sind für alles, was wir kennen, zwei Seiten derselben Medaille. Dieser Kreislauf wird metaphorisch im Buddhismus als Rad dargestellt. Der Buchtitel „Noch eine Runde auf dem Karussell“ (Tiziano Terzani) passt an der Stelle auch. Allerdings ist der Inhalt ein anderer.
Aufgrund der eigenen Beobachtungen in der Natur haben Menschen seit vielen tausend Jahren diesen ewigen Kreislauf erkannt. Wir erleben ihn um uns herum, wir selbst sind Teil dessen. Welche Schlüsse wir daraus ziehen, insbesondere was das uns unbekannte Leben nach dem Tod betrifft, ist zeitlich und gesellschaftlich unterschiedlich.
Die Ansicht, dass mit dem Tod „alles“ zu Ende ist, scheint nicht sehr verbreitet zu sein. Ein Argument ist, dass wir Menschen diese Einstellung nicht aushalten und als Ausweg aus der Misere und als Trostpflaster ein „Leben“ nach dem Tod als Modell konstruiert haben.
Sogenannte Nah-Toderlebnisse, das Verlassen des Körpers, ein Sog in ein Licht können Indizien für eine Existenz nach dem Tod sein. Hier wird als Gegenargument aufgeführt, dass es sich dabei auch um chemische Prozesse des Gehirns handeln könnte. Das gleiche gilt für Rückführungen in frühere Leben. Ein wissenschaftlicher Beweis fehlt (noch?). Es existieren Berichte von Menschen, die nach den Rückführungen von Orten oder Begebenheiten berichteten, die sie vorher nicht wissen konnten. Dies wird als Beleg für wirkliche Erlebnisse aus früheren Leben gewertet. Allerdings gibt es meines Wissens für diese Berichte keine überprüfbaren Quellenangaben.
Aber gibt es nur das, was wir bis jetzt beweisen können? Schließlich hat sich der Wissensstand der Menschen immer weiter entwickelt und ist noch nicht beendet.
- Konzepte der jenseitigen Welt in den Naturreligionen und Weltreligionen
- Die zentrale Fragen: Was ist das was bleibt? Wo ist dieses nach dem Tod? Warum gibt es Leben?
- Das Konzept von karma 1.24 und Wiedergeburt
- Ist der Glaube an Samsara im Yoga notwendig?
- Gibt es einen freien Willen oder ist durch karma alles vorher bestimmt?
- Die Auswirkungen der Konzepte auf die bewusste Lebensführung
- Die Auswirkungen auf unseren Alltag
- Konzepte der jenseitigen Welt in den Naturreligionen und Weltreligionen
Ausgrabungen, Entdeckungen in Höhlen oder von Grabstätten zeigen, dass Menschen schon seit langer Zeit von einem Leben nach dem Tod des Körpers überzeugt waren. Warum sonst wurden Verstorbenen Schmuck, Werkzeuge, Waffen, Nahrung und sogar Amulette mit ins Grab gegeben?
In Ägypten wurden Körper mumifiziert, damit die Seele den Körper wieder erkennen und finden konnte. (wikipedia)
In den Weltreligionen ist die Aussage recht ähnlich und eindeutig: Im Judentum, Christentum und im Islam gibt es eine „Auferstehung“- allerdings erst am „Jüngsten Tag“. Hier gibt es kein Konzept von Wiedergeburt als Mensch oder in anderer Form. Zwar gab es bei einer Gruppe, den christlichen Katharern, die Vorstellung von Wiedergeburt, aber sie wurden von der Inquisition verfolgt und ausgelöscht.
Aus dem Hinduismus ist das Konzept der Wiedergeburt bekannt geworden, obwohl es kein zentrales Element ist. Das Prinzip von Ursache und Wirkung bestimmt den ewigen Kreislauf des Lebens. Es ist deterministisch. So wird die Geburt in eine Kaste vom Verhalten der vorherigen Leben bestimmt. Das Ziel ist, den Kreislauf, der als leidvoll angesehen wird, zu beenden.
Der Buddhismus wird oft zu den Weltreligionen gezählt, ist aber keine Religion, sondern ein spirituelles Konzept ohne eine Gottheit. Buddha wurde im Leben „erleuchtet“, d.h. er hat die Vollkommenheit erreicht, aber er hat nicht den Status eines Gottes. Auch hier gilt die Erfahrung, dass Leben letztendlich Leiden ist, unterbrochen von kurzzeitigem und unbeständigem Glück. Der Zustand des ewigen Glücks, das Erleuchtung genannt wird, wird nicht erst nach dem Tod erreicht, sondern kann schon im jetzigen Leben erreicht werden. Buddha erlebte die Erleuchtung mit 35 Jahren. Es ist jedoch möglich, vielleicht wahrscheinlich, dass die meisten Menschen erst durch mehrere Existenzen gehen müssen, bevor ihr Geist erleuchtet wird.
In der Antike gab es in Griechenland ebenfalls das Konzept der „Seelenwanderung“. Möglicherweise ist aus Indien übernommen worden.
- Die zentrale Fragen: Was ist das was bleibt? Wo ist dieses nach dem Tod? Warum gibt es Leben?
Diese Fragen sind die großen Unbekannten und immer noch ungeklärt. Wenn Grabbeigaben mitgegeben werden, kann dahinter nur die Vorstellung stehen, dass die Verstorbenen an einem unbekannten Ort, der den Bedingungen auf der Erde sehr ähnlich ist, wieder einen Körper annehmen. Der alte Körper wird ja zurückgelassen.
Im Judentum, Christentum und Islam heißt es, dass die Toten „am Jüngsten Tag“, am Ende der Zeit, das von Gott bestimmt wird, auferstehen. Dann entsteigen die unverweslichen Körper ihren Gräbern. An anderer Stelle heißt es, dass die Seelen auferstehen. Es erfolgt eine Auf- bzw. Abrechnung: Die Taten im Leben werden bewertet oder es müssen Verse aus dem Koran zitiert werden. Anhand des Ergebnisses wird von einer „göttlichen Instanz“ über den weiteren Verbleib in einer Form von Himmel (vollkommenes Glück) oder Hölle (unendliche Qualen) entschieden (Quelle: wikipedia). Der Himmel wird traditionell mit oben, die Hölle mit unten und Dunkelheit assoziiert, so wie in der Antike von der Ober-und Unterwelt gesprochen wird. Da auch das noch kein Mensch erlebt hat, ist unklar, wo das „Paradies“ und die „Folterkammer“ sein könnte. Klar ist, dass diejenigen, die die Regeln der Religion (aus Überzeugung oder Angst) befolgt haben, einen Platz an der Seite Gottes bekommen. Die anderen werden verstoßen. Was der unverwesliche Körper oder die Seele ist, ist nicht klar.
Der Hinduismus und die anderen indischen Philosophien, auch Yoga, bleiben auch sehr vage: Es gibt eine Urkraft, atman oder brahman genannt, die sich in die Welt inkarniert. Diese Kraft hat auch den Kosmos erschaffen. Diese Urkraft ist ohne Anfang und ohne Ende und befindet sich in allem. Sie ist die Essenz. Da sie ewig ist, kann sie nicht geboren werden und nicht sterben. Wenn ein Körper, ein Wesen oder eine Pflanze stirbt, verändert sie nur ihre äußere Form. Der „Kern“ ist also transzendent und nicht materiell. Wir nennen diese Kraft oft Energie, etwas, das so fein ist, dass wir es mit unseren Sinnesorganen und unserem Geist nicht erfassen können. Die Rishis – Seher- haben dieses „geschaut“, also im Diesseits erfahren. Das ist der Unterschied zu den abstrakten Vorstellungen von Himmel und Hölle.
Der Buddhismus gründet auf der Erfahrung des Gautama Buddha, der die Einsicht, das vollkommene Wissen über alles Sein, Werden und Vergehen und die Überwindung von Leid erlangt hat. Es gibt keine Seele, kein persönliches Selbst, kein Bewusstsein, das wieder geboren wird und deshalb gibt es keinen Ort. Es sind „karmische Impulse“, die von Leben zu Leben wandern, was sich jeder Vorstellung entzieht.
Unsere Naturwissenschaften können bisher nichts zur Beantwortung dieser Fragen beitragen. Weder hat man bis jetzt eine Seele finden können noch ein Bewusstsein. Auch haben sie noch keinen transzendenten Raum gefunden. Vielleicht ist es so, dass es eine Dimension ist, die wir mit unseren wissenschaftlichen Methoden nicht beweisen können. „Neuere“ wissenschaftliche Thesen besagen aber, dass Energie nicht verloren gehen aber verschiedene Formen annehmen kann. Da auch wir Menschen aus Energie bestehen, können wir in einer anderen Form weiterbestehen. Andererseits berichtet nicht nur Buddha, sondern viele Menschen von eben solchen Erfahrungen. Und sie behaupten, dass diese Erfahrung allen Menschen zugänglich ist. Dafür haben sie Konzepte präsentiert.
Mit der Frage, was geschieht zwischen Tod und Wiedergeburt haben wir den zweiten Schritt vor dem ersten getan. Die Frage ist, WARUM entsteht überhaupt Leben? WIE Leben entsteht wurde mittlerweile so gut erforscht, dass wir in der Lage sind, es künstlich zu erzeugen. Aber warum entsteht Leben? Diese Frage ist auch schon alt und es gibt Antworten:
Die Bibel sagt, es gibt einen Schöpfer und alles Leben wurde von ihm geschaffen-in sechs Tagen (vielleicht hatten die Tage mehr als 24 Stunden…..). Den Menschen erschuf er als sein Ebenbild, als Mann und Frau. Die Schöpfung entspringt also dem Willen Gottes. Und das Ziel des Lebens ist die Rückkehr zu ihm.
Im Islam ist Allah der Schöpfer. Und auch seine Schöpfung will zu ihm zurück.
Im Hinduismus gibt es einen Schöpfergott (brahma), einen Erhalter (vishnu) und einen Zerstörer (shiva). Alle anderen Gottheiten sind Inkarnationen von Vishnu. Hier inkarnieren sich die Götter auch selbst um in das Geschehen einzugreifen oder die Menschen zu belehren. Im Hinduismus sind es also auch Göttter, die Leben erschaffen.
Vor dem Hinduismus gab es Samkhya. Der Grund, warum Leben entsteht, liegt in den beiden „Elementen“ purusha und prakriti begründet. Purusha ist reines Bewusstsein, prakriti ist Bewegungsenergie. Wenn prakriti mit purusha in Kontakt kommt, materialisiert sich das Bewusstsein. Es entsteht Leben. Der ganze Ablauf der Schöpfung wird mit den 25 Tattvas ausführlich erklärt.
- Das Konzept von karma 1.24 und Wiedergeburt
Der Begriff „karma“ ist seit dem Buch „Mieses karma“ zu einem geflügelten Wort geworden.
Der Sanskritbegriff karma bedeutet übersetzt „Tat“ oder „Handlung“. Es gibt gute und schlechte Handlungen. Was unterscheidet diese beiden Formen? Das Ergebnis, die Folge und Auswirkung. Der Begriff dafür lautet vipāka. Wenn also von karma gesprochen wird, ist eigentlich vipāka (1.23 / 2.13) gemeint.
Das Konzept von karma ist im asiatischen Raum seit den upanishaden bekannt. Es hat sich durch den Hinduismus in der indischen Kultur und durch den Buddhismus und Yoga im westlichen Raum ausgebreitet. Wie sieht dieses Konzept aus? Jede Handlung ist die Ursache für ein späteres Ereignis. Jedem Ereignis geht eine Ursache voraus. Wenn jetzt die Krokusse, Winterlinge und Narzissen sprießen ist die Ursache, dass Samen ausgesät oder Zwiebeln gepflanzt wurden bzw. sich selbst ausgesät haben. Weitere Ursachen sind eine vermehrte Sonneneinstrahlung und eine Erwärmung des Bodens. Auch die Samen und Zwiebeln haben eine Ursache: Eine Pflanze hat Samen oder Zwiebeln entwickelt. Und so kann man immer weiter zurückgehen. Es ist immer derselbe Kreislauf- samsara.
Wir Menschen können auf eine Ahnenreihe zurückblicken und enden bei kleinen Einzellern oder beim Sternenstaub. Alles, was wir betrachten können, in der Natur, in der Kultur, hat viele Ursachen, die zu vielen Ergebnissen geführt haben. Soweit so gut. Daraus ergibt sich nicht zwansgläufig die Idee der Wiedergeburt. Weshalb führen karma bzw. vipāka zu samsara?
Jede Handlung, sogar jeder Gedanke, jede Absicht, jedes Wort haben eine Wirkung-vipāka. Wenn diese Folge für den Menschen selbst, für andere Menschen und für andere Lebewesen keinen Schaden anrichtet, ist sie positiv. Im umgekehrten Fall ist das Ergebnis negativ. Dieses Ergebnis ist die Ursache für weitere Gedanken, Worte, Handlungen, die wahrscheinlich ein entsprechendes neues Ergebnis erzeugen. Wenn ein Mensch einen anderen anschreit wird dieser vielleicht zurückschreien oder schlimmstenfalls zurückschlagen. Dies kann aus Angst und Abwehr der Bedrohung gegen den Selbstwert oder den Körper geschehen. Dass sich für alle Beteiligten kein gutes vipāka einstellt, ist offensichtlich. Wenn ein Mensch einen anderen anlächelt oder freundlich anspricht ist die menschliche Reaktion wahrscheinlich auch eine freundliche oder zumindest neutrale Reaktion, weil er sich gesehen und akzeptiert fühlt. Das ist wiederum positives vipāka.
Auf diese Weise sammeln alle Menschen negatives und positives karma / vipāka. Das vipāka, ob positiv oder negativ, das in einem Leben nicht ausgeglichen wird, wird in das nächste Leben übertragen, so das Konzept. Er ist der Same für das nächste Leben. Wir sammeln so viel vipāka, dass immer etwas bleibt. Es gibt also etwas, das weiter exisitiert und das wiedergeboren werden kann bzw. muss. Leben wird als ein leidvoller Zustand erlebt, der überwunden werden soll und kann. Der Zustand von samādhi, die höchste Glückseligkeit wird dann erreicht, wenn es kein karma mehr gibt. Damit sind bestimmte Regeln bzw. Empfehlungen verbunden, denen man folgen kann. Sie sollen den Menschen befähigen, kein weiteres karma zu erzeugen- oder zumindest so wenig wie möglich und mehr positives. Es ist eine bestimmte Form der Lebensführung und keine Religion.
Wir können festhalten:
Es gibt zwei grundlegend verschiedene Konzepte:
Es gibt die Vorstellung von der Existenz eines Gottes, also eines Wesens, in einem fernen Raum, der die Geschicke des Menschen leitet. Dieser Gott hat die Autorität, Regeln, auch Gesetze zu erlassen, deren Befolgung belohnt und der Verstoß bestraft wird. Das Endziel der Glückseligkeit liegt im Jenseits. Das Leben ist lediglich eine Bewährungsprobe.
Die andere Vorstellung besagt, dass dieser glückselige Zustand im Menschen selbst liegt, weil es die Essenz des Menschen ist. Der Zustand kann im Leben oder auch in einer Existenz ohne Körper erfahren werden. Es gibt keine äußere Autorität. Der Mensch setzt die Ursache für sein Schicksal.
So ähnlich haben es die Mystiker im Mittelalter auch beschrieben: Teresa von Avila oder Franz von Assisi wußten von dem inneren Licht zu berichten. Diese Erfahrung gefährdete die Autorität und den Machtanspruch der Kirche, weshalb dieses Wissen unterdrückt wurde. Es zeigt jedoch, dass auch in unserer Kultur diese Erfahrung bekannt ist.
- Ist der Glaube an Samsara für die Yogapraxis notwendig?
Die Antwort hängt von der Quelle ab, auf die man sich bezieht. Die Bhagavadgita ist eine hinduistische Schrift über Yoga. Im 6.Kapitel Vers 45 heißt es sinngemäß, wer sich in vielen Leben darum bemüht, frei vom karma zu werden, erreicht den Zustand höchster Glückseligkeit. Er wird eins mit Krishna, Gott. Eine sehr bildhafte Sprache, die Raum für viel Fantasie, Missverständnisse und Irrtümer läßt. Der Text bedarf daher der Einführung durch einen kompetenten Lehrer.
Das Yogasutra, ein jüngerer Text als die Bhagavadgita, spricht nicht über eine Wiedergeburt. Diesem Text liegt die Samkhya-Philosophie zugrunde. An mehreren Stellen gibt es einen direkten Bezug. Die Essenz, purusha (1.16), die in jedem Menschen vorhanden ist, wird isvara genannt, ein purusha visesa, ein besonderer purusha (1.24). Dieser purusha entspricht atman. Um purusha zu erkennen, muss der Blick nach innen gerichtet werden. Es ist ein Prozess der Einsicht und zwar in diesem Leben. Das Ziel ist die Erkenntnis dessen was „wahres Selbst“ genannt wird, unser wirkliches Sein, ewig, unsterblich und vollkommen (1.25). Dieses Sein ist unabhängig vom Körper und unserem Geist. Es heißt samādhi (3.3) oder isvarapranidhāna (1.23 / 2.1 /2.45). Es ist die Einsicht in den Sinn des Lebens und die Freiheit von Leid. Es wird nicht ausgeschlossen, dass dieser Prozess mehrere Inkarnationen dauern kann. Es ist aber nicht ausdrücklich erwähnt.
Der Prozess wird im Yogasutra folgendermaßen beschrieben:
1. Die klesa (2.2. ff): Die Grundlage aller geistigen Aktivitäten sind die Triebkräfte unseres Ego: Selbsttäuschung / Verwechslung unseres vergänglichen Egos (avidyā 2.4 / 2.5). Wir identifizieren uns mit unserer sterblichen Existenz („ich“). Die Identifikation (asmitā 2.6) führt zu einem Festhalten an dem Ego (Körper, Menschen, Besitz, Überzeugungen / rāga 2.7). Um dieses Ego zu schützen wird einerseits so viel wie möglich festgehalten, weshalb rāga auch Gier und Sucht bedeutet und andererseits wird alles bekämpft, was das Ego körperlich, psychisch oder mental zu bedrohen scheint (dvesa 2.8). Wir befinden uns im Kreislauf von Identifikation, Festhalten und Abwehr. Das Problem sind nicht die realen Bedürfnisse oder akuten Bedrohungen, sondern die Aktivitäten unseres Geistes in Form von Vorstellungen, Erwartungen, Erinnerungen. Sie „färben“ unser Erleben und aktivieren immer wieder die klesa. Die klesa sind die Ursache für das Leid. Wir leiden an uns selbst, an unserem Geist. Wir identifizieren uns mit unseren Gedanken: Ich denke also bin ich (Descartes). Im Umkehrschluss endet die Existenz mit dem Denken (Tod).
2. Die klesa lösen geistige Aktivitäten- Gedanken und Gefühle- vrittis (1.5) aus. Die vritti sowie Worte und Taten hinterlassen einen Eindruck im Geist. Das nennen wir Erinnerung. Diese Erinnerung kann bewusst oder unbewusst sein. Die unbewussten Erinnerungen werden samskāra (1.18) genannt. Sie werden mit Samen verglichen, die im Boden ruhen und unter bestimmten Bedingungen aktiv werden. Sowohl die vrittis als auch die samskāra führen zu neuen Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten. Das ist der Kreislauf, in dem das Ego gefangen ist. Es ist ein Zustand des ständigen Mangels, der Unzufriedenheit, der Angst, Wut, Sorge, so dass die glücklichen Momente nicht von Dauer sind.
3. Subtiler als samskāra sind vāsanā (4.8.) Der Begriff wird mit „Geruch“ oder „Spur“ übersetzt. Diese Neigungen sind ganz feine samskāra und schwer zu fassen. In einigen Übersetzungen wird dies mit Eindrücken aus früheren Leben assoziiert. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang des Yogasutra jedoch nicht.
4. Diesem Kreislauf können wir nur entkommen, wenn wir uns unseres Selbst bewusst werden. Der Weg vom Ego zum Selbst wird im Yogasutra als achtgliedriger Pfad (astanga yoga 2.29) beschrieben.
Das Selbst (drastr 1.3 / isvara 1.23 / 1.24 ) ist transzendent. Es überdauert den Tod. Es ist ewig, unsterblich. Insofern kann es sich immer wieder eine neue Form der Existenz wählen. Das ist die Wiedergeburt. Warum sollte es das tun? Nicht aufgelöste samskāra und vāsāna sollen in einer neuen Existenz aufgelöst werden. Im Yoga geht es, wie bei allen genannten Konzepten der Wiedergeburt darum, eine Lebensweise zu praktizieren, die kein neues karma, kein karmasaya (Feld der samskāra 2.12) erzeugt und in einen Zustand der ewigen und höchsten Glückseligkeit (anuttama sukha 2.42) zu gelangen. Es ist ein Zustand der Freiheit vom karma (1.24).
Das Konzept des Yogasutra behandelt nicht das Thema der Wiedergeburt. Allerdings steht die Erfahrung eines tranzendenten Selbst, von dem wir nur wissen, dass es frei von dem Kreislauf ist, ewig und vollkommen, im Zentrum des ganzen Weges. Dieser Zustand ist im eigentlichen Sinne Yoga. Alles andere ist der Weg dorthin. Das Vertrauen (shraddhā 1.20) in ein solches Selbst ist Voraussetzung für Yoga. Man kann den achtgliedrigen Pfad auch unabhängig davon gehen, denn er verbessert die Lebensqualität, aber immer nur temporär, denn man bleibt im Kreislauf gefangen.
- Gibt es einen freien Willen oder ist durch karma alles vorher bestimmt?
Im Zusammenhang mit karma stellt sich die Frage nach dem freien Willen. Aus dem Konzept der Wiedergeburt folgt, dass wir nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen. Ob wir es Erbsünde, karma oder vipāka nennen wollen sei dahingestellt. Auf der naturwissenschaftlichen Ebene sind es die Gene. Die Epigenetik besagt, dass wir auch aus vorherigen Generationen Erfahrungen mitbringen. Aber das ist nicht dasselbe wie Wiedergeburt.
Einen freien Willen gibt es im Yogasutra in dem Rahmen, in dem wir frei von den klesa sein können. Das wird aklista (1.5) genannt. Ohne diese Fähigkeit macht der ganze Weg keinen Sinn. Samskāra und vāsanā sind die Saat für karma. Es ist aber die Entscheidung und damit die Verantwortung jedes Einzelnen, welchen Einfluss, welchen Raum den Anlagen oder Neigungen gewährt wird. Einer Veranlagung zur Gewalt oder Gier kann mit Bewusstsein entgegen getreten werden- oder auch nicht. Das ist nicht mehr altes, sondern neues karma.
Karma, die Handlung oder Absicht als Ursache, ist ohne Zweifel persönlich und vipāka, die Konsequenz ist es letztendlich auch. Das macht nur Sinn, wenn der Wille frei ist. Karma ist mitnichten deterministisch. Es gibt der persönlichen Entscheidung vielmehr eine besondere Bedeutung.
- Die Auswirkungen der Konzepte auf die Lebensführung
Warum werden die Konzepte von Buddhismus, Yoga, Konfuzius, die weit von unserer Zeit und unseren Lebensumständen entfernt zu sein scheinen, immer populärer? Das Leben, das wir bekommen haben, will gestaltet und gelebt werden. Tiere, die über ein Gedächtnis, aber kein Erinnerungsvermögen verfügen und ihren natürlichen Trieben ausgeliefert sind, haben keinen Gestaltungsspielraum. Menschen haben neben diesen Trieben ein Bewusstsein, mit dem sie diese Triebe lenken und einsetzen können -und müssen. Dieses Bewusstsein braucht einen Sinn / ein Ziel und eine Strategie, um das Ziel zu erreichen.
Über mehr als 2000 Jahre wurde dieser Sinn von der Religion im Sinne von Kirche vorgegeben. Es gibt das Bild vom guten Hirten und den Schafen. Damit diese Struktur funktioniert, gibt es Voraussetzungen:
– Der Hirte trägt die alleinige Verantwortung
– Der Hirte hat das Wohl der Schafe im Sinn
– Die Schafe vertrauen dem Hirten bedingungslos
– Die Schafe geben ihre Verantwortung freiwillig ab.
Der Machtmissbrauch der Hirten (Bischöfe, Priester), der zunehmende Wunsch nach Eigenverantwortung, die Aufklärung und die Naturwissenschaften führten zu einer Säkularisierung mit einer Abwendung von der Kirche. Aber immer noch waren die Menschen brave Untertanen, die ihrem Fürst oder Kaiser bedingunslos folgten. Kirche und Kaiser hatten immer recht. Notfalls wurde mit Gewalt „überzeugt“.
Auch diese Strukturen zerfielen und die folgenden- Kommunismus, Sozialismus und Kapitalismus -ließen die Menschen als Individuum zurück. Die Menschen müssen nunmehr selbst über ihr Leben entscheiden, haben viele Möglichkeiten, das Leben zu gestalten und ihm einen Sinn zu geben. Die „Götzen“, die den Menschen als Ersatz angeboten wurden und werden, waren und sind nicht tragfähig. Die Verzweifelung über diese empfundene Sinn-und Orientierungslosigkeit des eigenen Lebens zeigt sich in verschiedenen Süchten, Krankheiten, Kriminalität, Gewalt und Krieg.
Deshalb suchen immer mehr Menschen nach einer Gestaltung ihres Lebens, die sinnstiftend ist und Orientierung bietet. Die Entdeckung der östlichen Spiritualität bereits vor 100 Jahren durch einige wenige Menschen und der Boom in den 60er und 70er Jahren mit der Hippiebewegung haben dann diese östlichen Strömungen mehr und mehr in den Westen gebracht. Das Internet hat dann ein übriges dazu getan.
Die fernöstliche Spiritualität ersetzt die nahöstliche und europäische Spiritualität. Offensichtlich gibt es im Menschen eine tiefverwurzelte Sehnsucht nach Transzendenz. Das Yogasutra sagt, dass der Zustand von isvarapranidhāna das Gefühl ist, nach Hause zu kommen (cetana 1.29). Manchmal wird der Wunsch geäußert, „bei sich anzukommen“. Das klingt unlogisch, da wir körperlich garnicht anders können als bei uns zu sein. Es muss also etwas anderes sein. Und dieses Andere beschreiben die östlichen Konzepte. Dort können die Menschen andocken.
Zu diesem Ankommen, bei diesem Zuhause handelt es sich um ein Leben mit der Erfüllung tiefer innerer Bedürfnisse nach innerem und äußeren Frieden, Wahrhaftigkeit, Großzügigkeit, liebevollen, wertschätzenden Gedanken, Mitgefühl und Mitfreude. Alles dies, was auch als Werte bezeichnet werden kann, finden wir dort. Alles das sind wir wirklich. Das ist unsere tiefste Sehnsucht. Diese Ideen sind wesentlicher Bestandteil dieser Spiritualität. Deshalb wirken diese Lehren sinnstiftend. Und es werden dort Wege aufgezeigt, die dorthin führen. Es ist erreichbar. Sie geben Orientierung im Leben.
- Die Auswirkungen auf unseren Alltag
Wenn wir unseren Geist so benutzen, wie wir es gelernt haben und gewohnt sind, erzeugen wir immer wieder Unzufriedenheit, Schwierigkeiten, Probleme in unserem Leben und das vervielfacht sich in der Gesellschaft und in der Welt. Das können wir beobachten. Die Freude, das Glück können wir nicht dauerhaft halten-nicht weil es an der Welt oder den anderen Menschen liegt, sondern weil uns immer wieder die klesa in die Quere kommen. Wir leiden an unserem Geist.
Wenn wir daran etwas ändern wollen, müssen wir bei unserem Denken und Verhalten beginnen. Es gibt Verhaltensweisen, die die klesa reduzieren und den Geist friedlicher werden lassen. Das finden wir in den Zehn Geboten der Bibel, bei den Stoikern, bei Konfuzius, im Achtfachen Pfad der Erkenntnis im Buddhismus und im achtfachen Pfad des Yoga. Sie werden oft ethische Regeln genannt.
Unsere üblichen Denk-und Verhaltensmuster wirken im Alltag in der Regel unbewusst, ob beim Essen, der Arbeit, in der Familie. Deshalb ist eine Voraussetzung für die Änderung die Bewusstheit, was wir im jeweiligen Moment tun und warum wir es tun. Das heißt im Yogasutra svādhyāya (sva=Selbst und Studium 2.1 / 2.44). Bevor wir etwas ändern können, gilt es den Status quo herauszufinden. Daraus ergibt sich der Änderungsbedarf. Zum achtfachen Pfad gehört deshalb das Zurückziehen der Sinne (pratyāhāra 2.54). Die Sinne werden von den äußeren Eindrücken zu den inneren Prozessen gerichtet. Dann gilt es die Sinne dort immer länger ununterbrochen zu halten. Dieser Prozess nennt sich samyama (3.3). Er besteht aus den fließenden Übergängen von dhāranā (3.1), zu dhyāna (3.2), zu samādhi (3.3). Dieser Prozess wird durch Übung mehr und mehr zu einem allgemeinen Zustand auch im Alltag.
Die Meditation muss einhergehen mit einer Lebensweise, die den Geist zur Sammlung und Konzentration befähigt. Diese Lebensweise ist ein Prozess von einem egozentrierten, ängstlichen, agressiven, ablehnenden Geist (klesa 2.3) zu einem Geisteszustand und einer Funktionsweise, die als yama (2.29), niyama (2.40) und bhāvana (1.33) bezeichnet wird.
Die yama bestehen aus Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nichtstehlen, Nicht gierig sein, Genügsamkeit (ahimsā, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha). Der Geist entwickelt sich aus dem oben genannten Modus nach und nach in diesen Modus. Das sind die Leitlinien für ein spirituelles Leben:
Es bedeutet, im Alltag darauf zu verzichten, andere Menschen oder Lebewesen gedanklich, verbal oder körperlich zu verletzen bzw. dies zu dulden. Nur wenn es zum eigenen Schutz, in Notwehr erforderlich ist, ist es erlaubt.
Es bedeutet, im Alltag aufrichtig und authentisch zu denken, zu handeln und zu agieren und darauf zu verzichten, zu lügen, zu manipulieren oder zu hintergehen um sich bzw. seiner Gruppe Vorteile zu verschaffen.
Es bedeutet, im Alltag nichts zu nehmen, was nicht verdient ist. Es bedeutet darauf zu verzichten aus Ehrgeiz oder Gier sich an Gütern, Ruhm und Verdiensten anderer zu bereichern.
Es bedeutet, im Alltag seine Triebe zu beherrschen und darauf zu verzichten, jedem Impuls eines Bedürfnisses, seiner Gier zu folgen.
Es bedeutet, im Alltag zufrieden zu sein und das Erreichte wertzuschätzen und auf übermäßigen Ehrgeiz und Gier zu verzichten.
Mit den yama hängen die bhāvana zusammen: Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Toleranz (maitri, karunā, mudita, upeksa). Sowohl die yama als auch die bhāvana sind keine mentalen, rationalen Vorsätze, sondern müssen mit vollem Herzen gelebt werden. Dazu gehört auch, mit sich selbst in dieser Form umzugehen. Denn wie innen so außen.
Ein weiterer Zusammenhang besteht zu den niyama die da lauten: Reine Gedanken, Zufriedenheit, intensives Bemühen, Selbsterforschung und den Zustand der vollkommenen inneren Freiheit (sauca, santosha, tapah, svādhyāya, isvarapranidhāna).
Im Alltag bedeutet dies, durch ein Verhalten im Sinne der yama seinen Geist und seinen Körper auszurichten und der Verzicht auf die gegenteiligen, meistens unbewussten Gedanken und Handlungen der klesa.
Im Alltag bedeutet dies, in einem Zustand der Zufriedenheit, des inneren Friedens zu leben und darauf zu verzichten, ständig zu zweifeln oder alles ändern zu wollen, sondern das, was ist, wertzuschätzen.
Im Alltag bedeutet es, sich fortwährend um Bewusstheit zu bemühen und nicht in alte Muster zu verfallen.
Der entscheidende Punkt ist der letztendliche Zustand von vollkommener Freiheit, denn hier handelt es sich um das Nach-Hause-kommen. Nur in der Verwirklichung des Selbst (isvarapranidhāna) werden die yama, niyama, bhāvana letztendlich dauerhaft gelebt werden können. Alles Bemühen dient diesem Zielzustand. Es reicht weit über das Leben im Alltag hinaus. Dann entsteht kein neues karma und vipāka. Dann braucht es kein weiteres Leben mehr, sondern der vollkommene Zustand wird erreicht: sat-chid-ananda – Sein-Einheitsbewusstsein-Inneres Glück.
Yoga ist ein Weg in die innere Freiheit vom ersten Schritt an, denn sobald wir uns selbst unsere eigenen Ziele setzen, die gültig und unabhängig von den Gegebenheiten und äußeren Umständen sind, befreien wir uns von den Erwartungen und sich ständig verändernden Anforderungen. Die yama, niyama und bhāvana sind universelle, zeitlose, unveränderliche, vom Zeitgeist freie Werte. Sie sind die Konstante bei allen Veränderungen. Sie stehen immer mal wieder im Widerspruch zur äußeren Welt, die aber, das wissen wir, vergänglich ist. Es ist besser sein Haus auf einem festen, stabilen Boden zu bauen als auf einem schwankenden.
Wir können beobachten, wie aus Samen Pflanzen werden, sie wieder neue Samen produzieren bevor sie verwelken, verdorren, absterben, zu Humus werden und damit zur Nahrung für die Samen. Sie reinkarnieren sich in gewisser Weise. Das gilt auch für uns, soweit es die Materie, unseren Körper betrifft. Aber als Menschen sind wir mehr als Materie. Und darum geht es bei der Frage der Reinkarnation.
1.23 bedeutet 1.Kapitel 23.Sutra im Yogasutra
Audiodatei mit den Sanskritbegriffen
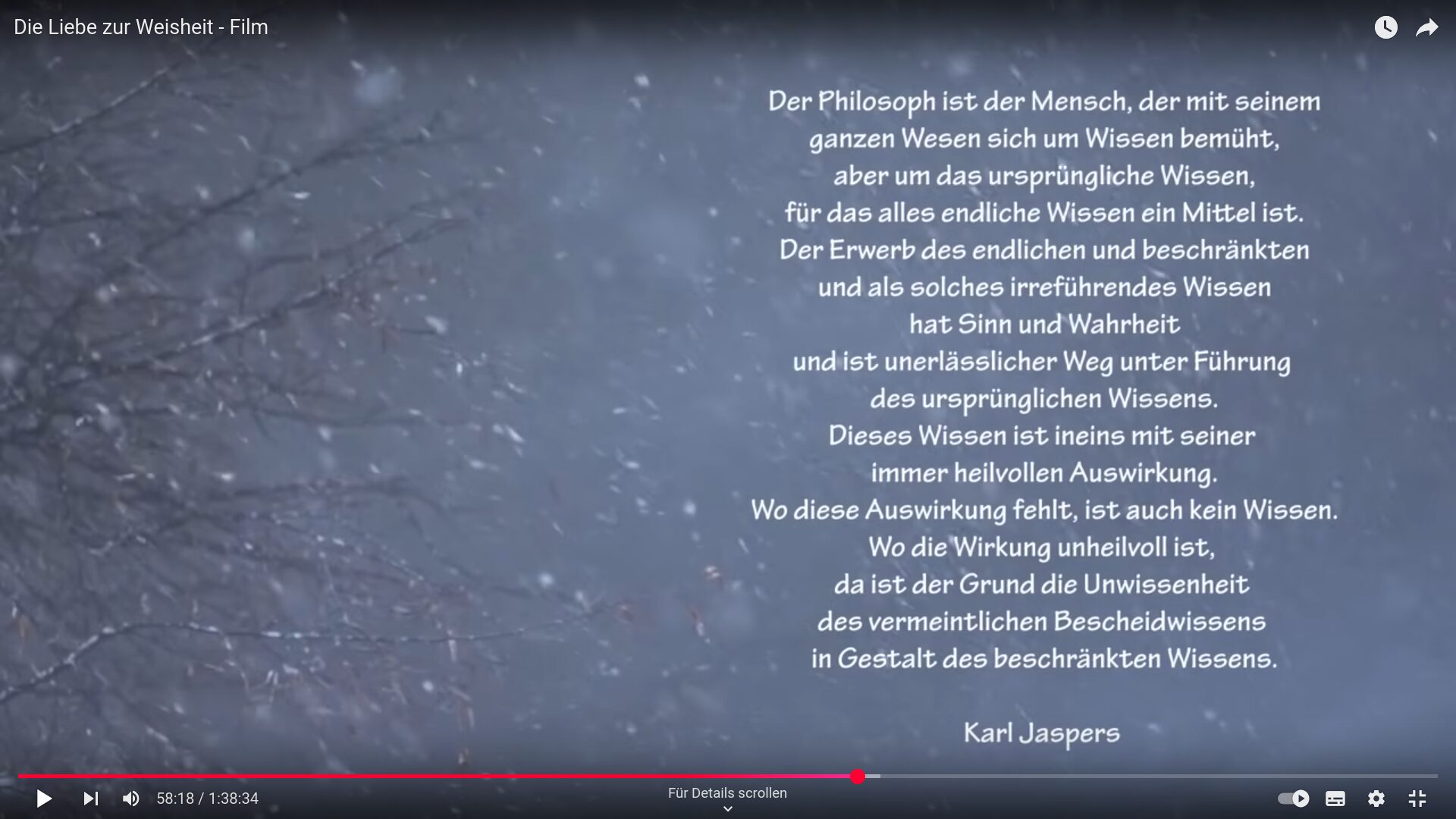
Drei zeitgenössische Koryphäen der Philosophie zu Sein, Ursache, karma:
Ein bekannter deutscher Autor:
Quelle: Die Kunst des inneren Weges / Victoria Film Production: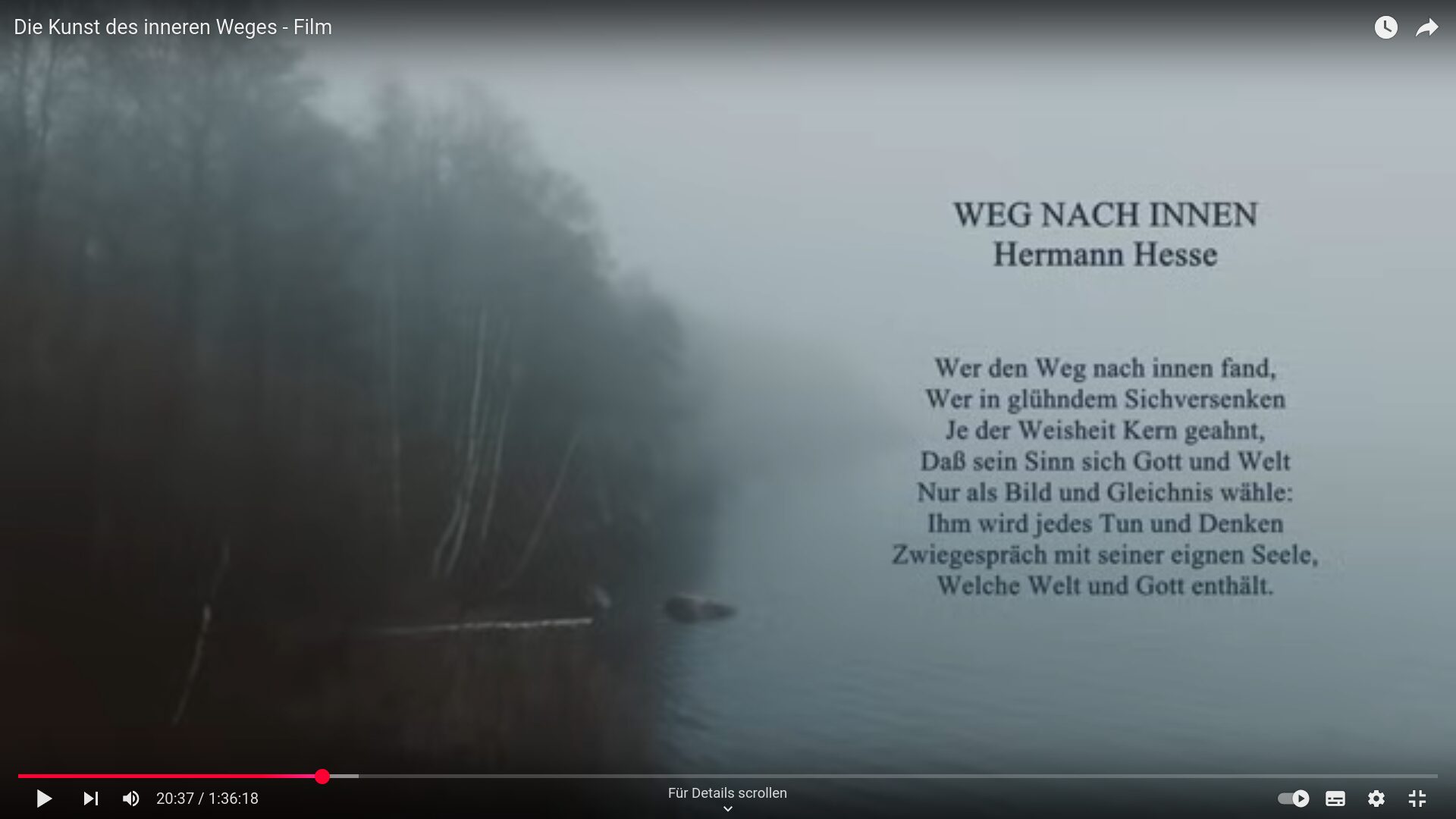
Und für „Leseratten“:
Die Anderswelt- Annäherung an die Wirklichkeit; Jochen Kirchhoff, Drachenverlag; ISBN:978-3-927369-07-8
